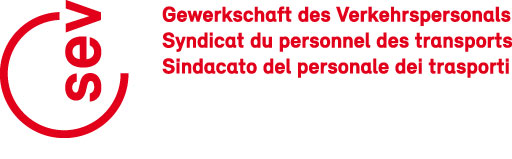Digitalisierung

Positionspapier Digitalisierung und Automatisierung/KI (2025)
- Der SEV gestaltet die digitale Transformation in den Unternehmen im Interesse der Mitarbeitenden mit.
- Digitalisierung und Automatisierung müssen zum Wohle der Mitarbeitenden sein.
- Die Mitarbeitenden sind bei der Einführung, Entwicklung und Überprüfung digitaler Arbeitsmittel einzubeziehen.
- Die Unternehmen stehen in der Pflicht, ihre Mitarbeitenden aus- und weiterzubilden.
- Einführung, Nutzung und Entwicklung sind sozialpartnerschaftlich zu regeln.
Digitale Transformation – sozial und demokratisch!
Die digitale Transformation bietet einerseits zwar grosse Chancen für sozialen Fortschritt, birgt andererseits aber enorme Risiken, dass erkämpfte soziale Errungenschaften zerstört werden. Voraussetzung dafür, dass sozialer Fortschritt resultieren kann, sind die demokratische Kontrolle und Steuerung des digitalen Wandels. Grundrechte und gewerkschaftliche Rechte dürfen nicht durch Einsatz digitaler Technologien ausgehöhlt werden. Der SEV als Gewerkschaft des Verkehrspersonal hat den Anspruch, diese Entwicklungen aktiv im Interesse der Mitarbeitenden mitzugestalten, weil es letztendlich um die Frage geht, wie wir künftig arbeiten und leben wollen.
Arbeit 4.0: Digitalisierung und Automatisierung
Die digitale Transformation bewirkt wachsende Vernetzung der Gesellschaft über alle Lebensbereiche hinweg. Insbesondere drahtgebundene und drahtlose Kommunikationsnetze ermöglichen, eingebettete Systeme zu vernetzen. Als Konsequenz dieser Entwicklung entstehen cyber-physische Systeme (CPS), die die Steuerung von Arbeitsprozessen mittels Computer erlauben. Ziel der digitalen Transformation ist es, die Arbeitsprozesse immer weiter zu automatisieren. Verschlankung und Flexibilisierung der Arbeitsprozesse führen in der Tendenz zu loseren, individualisierten Arbeitsverhältnissen und höherer Selbstverantwortung der Mitarbeitenden. Automatisierung und Robotisierung bzw. der Einsatz von sogenannt «künstlicher Intelligenz» (KI) verändern nicht nur Arbeitsinhalte, Arbeitsprozesse und Berufsbilder, sondern auch die Interaktion zwischen Arbeitnehmenden und Maschinen.
Die digitale Transformation darf nicht zu Plattformisierung und Prekarisierung führen. Die Arbeitsbeziehungen müssen auch weiterhin sozialpartnerschaftlich geregelt sein und soziale Sicherheit schaffen.
Mobilität 4.0: Entmenschlichung des öV verhindern
Auch im öV schreitet die Automatisierung der Arbeitsprozesse voran, sei es beim Fahrpersonal, in den Werkstätten, im Verkauf oder in der Administration. Trotz Digitalisierung und Automatisierung braucht der öV aber Gesichter: Menschen, die in Zügen, Bussen und an Bahnhöfen Vertrauen schaffen, Auskunft geben, Sicherheit vermitteln und bei Problemen helfen. Der öV darf nicht entmenschlicht werden und muss weiterhin für alle zugänglich sein, mit oder ohne Smartphone.
Interoperabilität bringt europäische Standards
Die digitale Transformation beeinflusst die technischen Standards des Eisenbahnverkehrs weltweit. Infolge der zunehmenden Vernetzung der nationalen Eisenbahnsysteme zu einem europäischen Netz werden technische Standards europaweit harmonisiert. Grenzüberschreitende Schienenverkehre setzen Interoperabilität voraus, was den Gestaltungsspielraum für nationale Regelungen einschränkt. Deshalb bringt sich der SEV auf europäischer Ebene aktiv ein.
Technologischer Wandel zum Wohle der Mitarbeitenden
Der SEV steht der digitalen Transformation grundsätzlich positiv gegenüber, vorausgesetzt sie ist zum Nutzen der Mitarbeitenden. Die Entwicklung soll sich an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden orientieren. Ausserdem müssen diese auch monetär an den Produktivitätsgewinnen teilhaben. Die Unternehmen müssen ihre soziale und ethische Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Eigner:innen und Kundschaft wahrnehmen. Die sozialpartnerschaftlichen Errungenschaften müssen abgesichert und die sozialpartnerschaftlichen Beziehungen gestärkt werden.
Flexibilisierung im Sinne der Mitarbeitenden gestalten
Arbeiten wird flexibler und mobiler, wodurch sich im Idealfall Berufs- und Privatleben besser vereinbaren lassen. Dazu sind geeignete Arbeitszeitmodelle und technische Hilfsmittel für ortsungebundenes Arbeiten erforderlich. Klar zu regeln sind die Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit sowie die private Nutzung von Geräten.
Mitgestalten: Mitwirkungsrechte und Mitwirkungsprozesse stärken
Einführung oder Überarbeitung neuer digitaler Arbeitsmittel
Die Mitarbeitenden sind frühzeitig in die Einführung und Weiterentwicklung digitaler Arbeitsmittel miteinzubeziehen. Anwendungen werden bedarfsgerecht geschult. Für die Schulung ist genügend Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen und eine allfällige Nutzung privater Ausrüstung muss entschädigt werden. Zudem ist eine Anlaufstelle einzurichten, die bei Bedarf kurzfristig erreichbar ist.
Qualifikation Mitarbeitende und Personalkommissionen
Um sich wirkungsvoll in die Mitwirkungsprozesse einbringen zu können und Diskriminierungsfallen zu erkennen, ist ein Grundverständnis algorithmischer Systeme, rechtliches und ethisches Grundwissen sowie Fachwissen über die betroffenen Arbeitsprozesse nötig. Es ist Aufgabe des SEV, Mitglieder von Personalkommissionen systematisch zu schulen und in Mitwirkungsprozessen fachlich zu unterstützen. Ein entsprechendes Bildungsangebot steht bereit und kann genutzt werden.
Berufliche Qualifizierung ermöglichen
Neue Berufsbilder entstehen, andere verändern sich oder verschwinden gänzlich. Unternehmen sind in der Verantwortung, ihre Angestellten weiterzubilden, so dass sie mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten können. Der SEV setzt sich für die gezielte Nachqualifizierung, Aus- und Weiterbildung ein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass digitale Weiterbildungstools nicht für alle Mitarbeitenden geeignet sind. Deswegen sind auch nicht-digitale Alternativen anzubieten. Für Mitarbeitende, die dem digitalen Wandel nicht gewachsen sind, müssen Lösungen gefunden werden, dank denen sie trotzdem im Arbeitsprozess bleiben können. Der SEV fordert bei der Entwicklung von Berufsbildern eine enge Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern
Mitarbeitendenrechte und Autonomie schützen
Datenschutz gewährleisten
In automatisierten Prozessen werden kontinuierlich Daten von Mitarbeitenden gesammelt. Für ihren Schutz ist deshalb die Einhaltung des Datenschutzes zwingend. Daten dürfen nur zweckgebunden bearbeitet werden und nur sofern die betroffenen Mitarbeitenden freiwillig eingewilligt haben. Das Recht auf Dateneinsicht ist Mitarbeitenden uneingeschränkt zu gewähren. Die Nutzung von personenbezogenen Daten, insbesondere für Leistungs- und Verhaltenskontrollen, ist sozialpartnerschaftlich zu regeln.
Sozialpartnerschaft weiterentwickeln
Gesamtarbeitsverträge ergänzen
Der Einsatz digitaler Technologie, insbesondere von algorithmischen Systemen muss zwischen den Sozialpartnern verbindlich geregelt werden. Dabei sind Themen wie Einbezug der Sozialpartner bei Entwicklung und Einführung digitaler Arbeitsmittel, Datennutzung, Datenschutz, Datensicherheit, Transparenz, Datenquellen sowie Qualifikation und Mehrwert für die Mitarbeitenden zu regeln. Für den Fall der Einführung neuer Technologien sind Mitbestimmungsrechte zu verankern.
Zugang der Gewerkschaften zu den Mitarbeitenden
Weil die Arbeit zunehmend flexibel und dezentral organisiert ist, brauchen die Gewerkschaften auch ein virtuelles Zutrittsrecht zu Betrieben. Nur so können sie, auch ortsungebundene Mitarbeitende kontaktieren und sie über ihre Rechte aufklären.