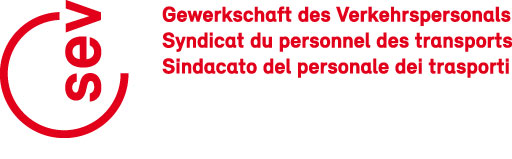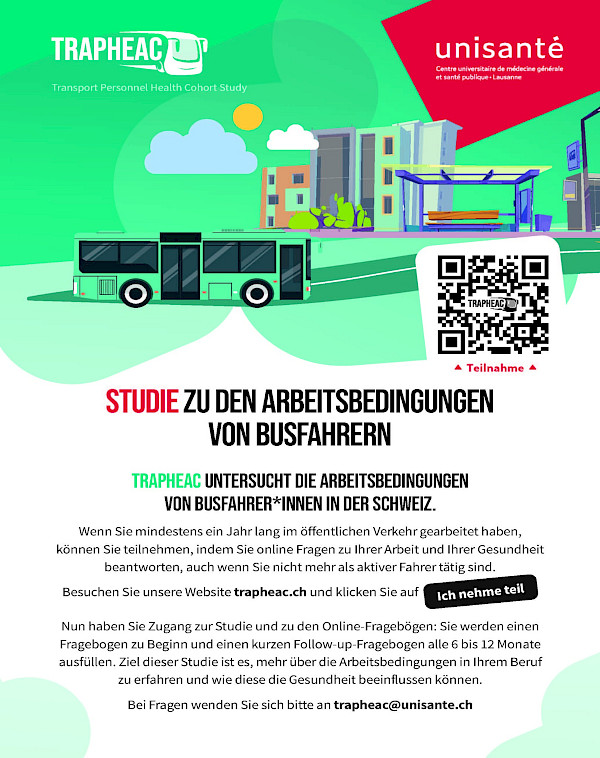Bahnliberalisierung unter der Lupe
Fehlentwicklung in Schweden
Was hat die Liberalisierung der Bahn in Schweden gebracht? Das hat die schwedische Forscherin Malin Malm für den Thinktank Katalys untersucht. Die Resultate zeigen, 40 Jahre Marktliberalisierung und Deregulierung haben keine Verbesserungen gebracht. Im Gegenteil: Heute ist eine Neuausrichtung dringend erforderlich, um die Eisenbahn für die Herausforderungen der Zukunft zu stärken
Der Bericht «Market reforms at the end of the road: How we create a functioning railway for the 2030s» von Malin Malm analysiert die Entwicklung des Eisenbahnsektors in Schweden im Besonderen und in Europa im Allgemeinen. Überall in Europa ist die Eisenbahn ein energieeffizientes Verkehrsmittel mit hoher Kapazität für den Transport von Gütern und Personen. Sie spielt eine zentrale Rolle in der zivilen und militärischen Notfallvorsorge, wie etwa im Krieg in der Ukraine, wo sie für Evakuierungen und den Transport von Ausrüstung entscheidend ist. Gleichzeitig ist die Eisenbahn investitionsintensiv und weniger flexibel als andere Verkehrsmittel wie Autos oder Flugzeuge. Sie erfordert langfristige Planung und eine gut ausgebaute Infrastruktur mit entsprechenden Kosten.
Die Entwicklung der Eisenbahnorganisation in Europa beginnt im Bericht mit der Nationalisierung im 20. Jahrhundert, die Effizienz und Koordination förderte. In den 1980er-Jahren begann die Deregulierung, angeführt von Schweden, das 1988 die Trennung von Infrastruktur und Verkehr einführte. Diese Reformen wurden später durch die EU mit vier sogenannten «Railway Packages» weiter vorangetrieben, die Wettbewerb und Marktöffnung fördern sollten.
Probleme der Marktliberalisierung
Malin Malm nennt mehrere Probleme, die durch die Marktliberalisierung entstanden sind:
Wettbewerbsfähigkeit: Die Bahn hat Marktanteile gegenüber anderen Verkehrsmitteln wie Strassenverkehr und Luftfahrt verloren. Trotz EU-Zielen, den Anteil des Schienenverkehrs zu erhöhen, stagniert oder sinkt dieser.
Sozialisierung von Verlusten: Unprofitable regionale Strecken werden durch Steuergelder finanziert, während profitable Linien privatisiert werden. Dies führt zu einer ungleichen Verteilung der Kosten und Gewinne.
Arbeitsbedingungen: Deregulierungen haben zu schlechteren Arbeitsbedingungen für das Bahnpersonal geführt, was soziale Konflikte und Sicherheitsprobleme verschärft hat.
Keine Anreize für private Investitionen: Der Markt wird von wenigen grossen staatlichen Unternehmen dominiert, die miteinander konkurrieren. Private Unternehmungen wurden kaum angezogen.
Schwächung der Notfallvorsorge: Die Fragmentierung des Systems erschwert die Mobilisierung von Ressourcen in Krisensituationen.
Erfolgsbeispiele und Neuausrichtung
Spanien wird als positives Beispiel genannt, wo Investitionen in Hochgeschwindigkeitsstrecken zu niedrigeren Ticketpreisen und mehr Reisen geführt haben. Spanien hat das grösste Hochgeschwindigkeitsnetz Europas, was die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn gestärkt hat. Der Bericht argumentiert jedoch, dass diese Erfolge eher auf Infrastrukturinvestitionen als auf Marktliberalisierung zurückzuführen sind.
Im Bericht empfiehlt Malin Malm eine Neuausrichtung der europäischen Eisenbahnpolitik und schlägt drei zentrale Prioritäten vor:
Öffentliche Vorteile priorisieren: Die Eisenbahn sollte als öffentliche Infrastruktur betrachtet werden, die der Gesellschaft dient. Wettbewerb sollte nicht das Hauptziel sein, sondern die Förderung des öffentlichen Nutzens, vor allem auch Notfallvorsorge und Klimaschutz.
Europäische Wettbewerbsfähigkeit stärken: Die Interessen der Reisenden sollten über die Eigeninteressen der Eisenbahnunternehmen gestellt werden. Monopolartige Strukturen müssen reguliert werden, um die Effizienz und Zugänglichkeit des Systems zu verbessern.
Gute Arbeitsbedingungen sichern: Langfristig stabile und faire Arbeitsbedingungen sind entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des Eisenbahnsystems. Gewerkschaften und Gesamtarbeitsverträge sollten respektiert werden, um Konflikte zu reduzieren und die Attraktivität des Sektors zu erhöhen.
Der Bericht kommt zum Schluss, dass die bisherigen Markt- und Wettbewerbsorientierungen nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert haben. Stattdessen sollte die Eisenbahnpolitik stärker auf öffentliche Vorteile, europäische Zusammenarbeit und soziale Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Eine neue EU-Strategie könnte die Grundlage für ein robustes und zukunftsfähiges Eisenbahnsystem schaffen, das den Herausforderungen der 2030er-Jahre gewachsen ist.
Michael Spahr