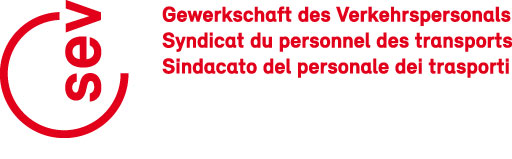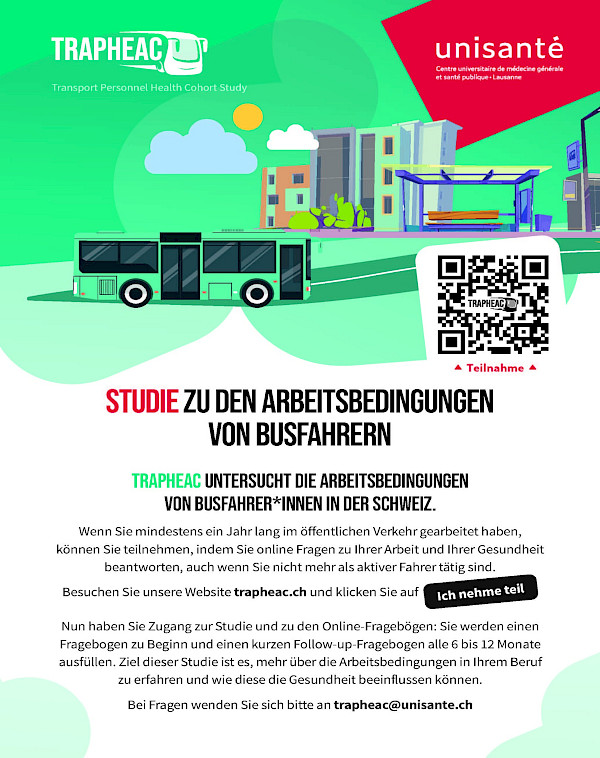Just Transition
Gerechter Wandel für alle
«Just Transition» bedeutet den Wandel einer Gesellschaft möglichst gerecht zu gestalten. Durabilitas ist ein Labor für eine nachhaltige Schweiz, das Organisationen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt, worunter auch Gewerkschaften wie den SEV. Gemeinsam diskutiert man, wie man den sozialen und ökologischen Wandel möglichst gerecht und breit abgestützt gestalten kann.
Im Kampf gegen den Klimawandel setzt die Politik oft auf technokratische Lösungen, um den Ausstoss von Treibhausgasen bis 2050 auf null zu senken. Bisher mit wenig Erfolg. In Frankreich hat die Gelbwesten-Bewegung 2018 klar gemacht, dass die Rechnung nicht aufgeht, wenn im Namen der Klimapolitik die Benzinpreise erhöht werden, während die Bevölkerung ausserhalb der grossen Zentren aufs Auto angewiesen ist. In der Schweiz hat das Volk im Juni 2021 das CO₂-Gesetz abgelehnt, insbesondere weil es für die Landbevölkerung zu einschränkend und die steuerliche Belastung zu hoch erachtet wurden.
Diese Beispiele zeigen, dass ein Strukturwandel nicht gelingen kann, wenn der Gedanke von Just Transition nicht einbezogen wird, also soziale und gesellschaftliche Fragen ausser Acht bleiben. Dies schafft Ungerechtigkeiten und ist deshalb aussichtslos. Das ist die Erkenntnis von Durabilitas, das sich als «unabhängigen Think- und Do-Tank für eine nachhaltige Schweiz» bezeichnet: «Bei genauer Betrachtung der Situation gibt es eine wesentliche Feststellung: Die soziale Gerechtigkeit wird nicht berücksichtigt.» Das Konzept von Just Transition hält fest, dass ein ökologischer Wandel ohne Rücksicht auf die Gerechtigkeit nicht gelingen wird. «Mit anderen Worten: Die Beseitigung von Ungerechtigkeiten bei der Umsetzung des Wandels ist eine Grundbedingung für ebendiesen Wandel.»
Anfänglich eine Idee der Gewerkschaften
Der Gedanke eines gerechten Strukturwandels ist eigentlich nicht neu. Er hat seinen Ursprung in den Kämpfen der US-amerikanischen Gewerkschaften in den 80er-Jahren, als sie sich für Unterstützungsfonds zugunsten der Arbeiterinnen und Arbeiter einsetzten, die ihre Arbeitsplätze aufgrund von ökologischen Entwicklungen in den Sektoren Öl, Chemie und Atomenergie verloren. Heute ist die Idee weit verbreitet und beispielsweise Teil des Pariser Umweltabkommens von 2015. Die Internationale Arbeitsorganisation erklärte Ende 2024 an der COP29 der UNO: «Die Politik des gerechten Wandels muss faire, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Vordergrund stellen.»
Durabilitas hält fest, dass «die Unbestimmtheit oder gar das Fehlen von Fragen der sozialen Gerechtigkeit in der Schweizer Umweltpolitik erschreckend» ist. Während einfache und verletzliche Menschen verhältnismässig wenig zur Umweltzerstörung beitragen, sind sie der Verschmutzung und den Umweltschäden überdurchschnittlich ausgesetzt. Ein Artikel in «Le Temps» zeigt dies an einem Beispiel: Vernier – lange als Genfs «Abfalleimer», zwischen Fluglärm, Öltanks und verschmutzten Zonen – wird verglichen mit dem wohlhabenden Vandoeuvres am linken Seeufer, das solche Belastungen nicht kennt, dafür Pärke und guten öffentlichen Verkehr hat. Deutlich wird: Umweltpolitik trifft diese Ortschaften völlig ungleich.
Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit
Nichtstun und der Verzicht auf einen Wandel haben negative Auswirkungen, die gut belegt sind. Doch auch eine Politik des Wandels birgt Risiken für zusätzliche soziale Ungerechtigkeiten. Durabilitas legt sein Augenmerk auf diese wenig beachteten Gefahren. Man muss einschätzen, welche Einflüsse die Umweltpolitik auf die einzelnen Personen und Gruppen hat. Man muss also die soziale Blindheit der Politik bekämpfen: «Es gibt keine nachhaltige Schweiz ohne soziale Gerechtigkeit.» Soziale Gerechtigkeit und Mitbestimmung müssen bei der Umweltpolitik im Mittelpunkt stehen. Davon ist man weit entfernt, wenn man eher auf «Sozialverträglichkeit» abzielt als auf den Abbau der ökologischen Ungleichheit. Durabilitas stellt fest: «Der sozio-ökologische Wandel kann nicht gegen und ohne die Menschen gemacht werden.»
Runde Tische
Dieses Jahr fanden in Lausanne und Bern zwei runde Tische statt, um diesen Ansatz in der Schweiz vorzustellen und mit verschiedenen Beteiligten der Zivilgesellschaft zu diskutieren: Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, öffentliche Verwaltungen, Forschung und andere. Der SEV nahm daran teil und betonte, dass der öffentliche Verkehr eines der Mittel gegen den Klimawandel ist. Er erläuterte, dass soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz miteinander verbunden sind. Für die Attraktivität der Verkehrsberufe ist es zentral, dass sich die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern.
Nach den beiden Phasen der Projektentwicklung und der Mobilisierung einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren beginnt nun eine dritte Phase. Diese soll soziale Gerechtigkeit, soziale Rechte und Mitwirkung in den Mittelpunkt der Umweltpolitik zu stellen. Es geht darum, zusammen mit den Betroffenen Methoden zur Risikobewertung zu entwickeln. So etwa zu den Auswirkungen von Hitzewellen oder zu Massnahmen für eine umweltfreundliche Mobilität. Wichtig ist, dass hier auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in diesem Bereich berücksichtigt werden. Am Anfang steht die gemeinsame Erhebung der Risiken zusammen mit den Beschäftigten – und ihren Vertretungen –, denen diese ausgesetzt sind. Damit der gerechte Wandel mehr als einfach nur Wandel ist.
Yves Sancey