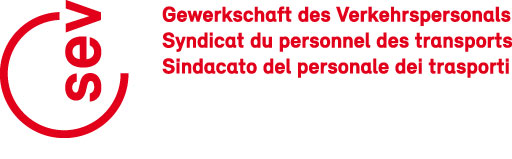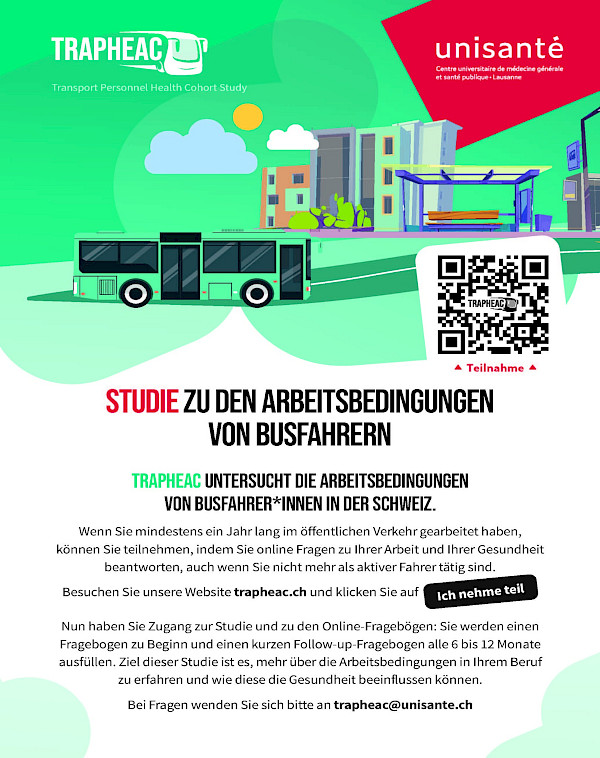Link zum Recht
Wohnhaft in Deutschland – gekündigt in der Schweiz
Wer in Deutschland wohnt, aber in der Schweiz arbeitet, gehört zur Gruppe der sogenannten Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Wird ein solches Arbeitsverhältnis aufgelöst, stehen Betroffene plötzlich zwischen zwei Sozialsystemen – dem der Schweiz und jenem ihres Wohnsitzlandes. Für diese Situation gelten besondere Regeln, die im Freizügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und der EU sowie in der EU-Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der sozialen Sicherheit festgelegt sind.

Für Grenzgängerinnen und Grenzgänger ergeben sich daraus klare Zuständigkeiten – aber auch eine klare Eigenverantwortlichkeit. Nachfolgend die wichtigsten Punkte im Überblick:
1. Arbeitslose Grenzgänger:innen müssen sich bei der «Agentur für Arbeit» in ihrem deutschen Wohnort melden – nicht in der Schweiz. Und dies möglichst zeitnah, da verspätetes Handeln zu finanziellen Nachteilen führen kann.
2. Da der oder die Betroffene nicht im deutschen Sozialsystem gearbeitet hat, müssen die Versicherungszeiten in der Schweiz gegenüber der Agentur für Arbeit nachgewiesen werden. Dies geschieht über das EU-weit anerkannte «PD U1»-Formular, das bei der zuständigen Arbeitslosenkasse in der Schweiz oder beim Seco (Staatssekretariat für Wirtschaft) beantragt werden kann. Der Nachweis liegt in der Verantwortung der betroffenen Person und ist zwingend erforderlich, damit das deutsche Arbeitsamt die Leistungen korrekt berechnen kann.
3. Obwohl das Arbeitslosengeld in Deutschland auf Grundlage des in der Schweiz erzielten Lohns berechnet wird, führt das in der Praxis häufig zu einer tieferen Leistung. Der Grund: In Deutschland gelten andere Berechnungsgrundlagen. In der Schweiz erhält man in der Regel 70 bis 80 Prozent des versicherten (Brutto-) Verdienstes, während in Deutschland 60 Prozent (bzw. 67 Prozent mit Kind) des pauschalierten Nettoverdienstes gezahlt werden.
4. Mit dem Bezug von Arbeitslosengeld ist die arbeitslose Person in Deutschland automatisch gesetzlich kranken- und pflegeversichert. Die bisherige Krankenversicherung in der Schweiz – meist eine KVG-Versicherung – ist somit nicht mehr nötig und muss gekündigt werden. Eine Doppelversicherung ist nicht erlaubt und würde lediglich zusätzliche Kosten verursachen.
5. Kündigung bedeutet auch Austritt aus einer Schweizer Pensionskasse. Wer sich weiterhin gegen die Risiken Invalidität und Tod absichern möchte, kann dies freiwillig über die Stiftung Auffangeinrichtung BVG tun. Das bedingt, dass die betroffene Person in einem EU- oder Efta-Land wohnt, der letzte Arbeitgeber BVG-pflichtig war und der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach Anstellungsende gestellt wird. Die Prämien gehen zulasten der betroffenen Person.
6. Das bestehende Altersguthaben aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule) kann auf ein Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice bei einer Bank oder einer Versicherung in der Schweiz übertragen werden. Dort bleibt das Guthaben bis zu einem neuen Vorsorgefall (z. B. bei Antritt einer neuen Stelle mit Pensionskasse), der Pensionierung oder – in Sonderfällen – einer Auszahlung.
Als Grenzgänger:in ist man zwischen zwei Systemen. Aber wer gut informiert ist und rechtzeitig handelt, kann Nachteile vermeiden und den Übergang besser bewältigen.
Rechtsschutzteam SEV